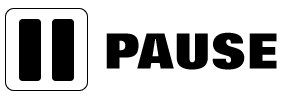Beobachtungen (‚Observations‘)
Ziel:
Beobachtungen ermöglichen den Einblick in einige ausgewählte Alltage und helfen, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie extrem unterschiedlich diese sein können. Schliesslich muss eine Zielgruppe (Berufsfeld, ein Typ Mensch, eine Situation oder ein Ort) bestimmt und argumentiert werden.
Auswahlkriterien:
Die dokumentierten Beispiele sind bewusst ausgewählte und möglichst unterschiedliche Menschen in extremen Positionen („extreme-users“), die besucht, begleitet, beobachtet, gezielt befragt und in Gespräche verwickelt wurden. Neben Kriterien wie angestellt/ selbständig, körperliche/ geistige Anstrengung, einsame/ gesellige Arbeitssituation, verantwortungsbeladene/ ausführende Position etc. wurde die schlussendliche Auswahl jedoch auch stark von der Zu- und Absagen der Angefragten beeinflusst (Sicherheitsvorschriften, Vertraulichkeit, organisatorischer Aufwand, Verfügbarkeiten, Offenheit und Interesse für das Thema).
Bei den Beobachtungen interessierten mich besonders jene Berufsfelder, die mir zuvor eher fremd waren. Dass das Resultat so stark männerlastig ausfallen würde, zeichnete sich erst mit der Zeit ab und war nicht gewollt: ein Fassaden-Isolateur, ein Kranführer, ein Lokführer, ein Manager, ein Fabrikarbeiter, ein Handwerker, ein Orchestermusiker, ein Jazzmusiker und eine Primarschülerin.
Es ist klar, dass sich die Schwerpunkte bei tieferer Themenkenntnis verschieben und somit immer noch weitere Beobachtungen aufdrängen. Die Einsichten können nie alle Ausprägungen der facettenreichen Wirklichkeit wiederspiegeln; Erkenntnisse ermöglichen sie allemal.
Erlebnis:
Die Beobachtungen haben viele spannende Einblicke in Alltage und viele interessante Gespräche ermöglicht. Ich fand diese Methode sogar so bereichernd, dass ich sie – wenn beruflich möglicherweise nicht so oft möglich, weil sehr aufwändig – aus privatem Interesse an anderen Lebenssituationen und Perspektiven im Sinne einer Erweiterung des Weltbildes für mich privat wieder anwenden möchte!
Erkenntnisse:
Ursprünglich hatte ich von Beschattung (‚Shadowing’) gesprochen, habe aber bald eingesehen, dass diese Bezeichnung unrealistisch ist: Die eigene Präsenz ist zu offensichtlich (jedenfalls mit einem begrenzten Zeitrahmen) und braucht die Zustimmung der Beteiligten. Es ist also so gut wie unmöglich, eine Beeinflussung der beobachtbaren Szenen zu umgehen.
Ausserdem bekommt man mit Fragen man oft vielsagendere (weil weniger stark interpretierte) und vor allem raschere Erkenntnisse als durch blosses Beobachten. Natürlich besteht dabei auch die Gefahr, dass man sich als BeobachterIn von bewussten oder unbewussten Fehlberichten (allzu positiv/ negativ) irreleiten lässt: Interpretation und Intuition sind gefährlich aber auch nötig.
Beim Thema ‚Pause’ war die aktive Auseinandersetzung speziell interessant, weil die beobachteten Personen dadurch einen Sensibilisierungsprozess zu durchliefen. Dies führte zu Erkenntnissen wie: „Krass, das mache ich ja nie!“ Allgemein wurde dieses Bewusstwerden über den Umgang mit der eigenen Zeit sehr geschätzt.
Arbeitspsychologische Grundlagen und eigene Thesen lassen sich durch illustrierende Beispiele viel besser argumentieren oder auch relativieren: Aus Beobachtungen lassen sich zwar keine verallgemeinernde Schlüsse ziehen, doch sie lassen die unendliche Vielfalt erahnen und schaffen Verständnis für Menschen in extremen Positionen.
Auf mein Projekt mit dem Ziel eines handfesten Produkts bezogen, zeigten die Beobachtungen auf, dass die Pausenbedürfnisse grundsätzlich relativ problemlos gedeckt werden. Wenn einmal ein Gegenstand dazu fehlt (weil er nicht zur Hand war), führt das meist zu Improvisationen, die in der Regel bestens funktionieren. Es ist unmöglich, nicht unbedingt erwünscht und auch nicht mein Ziel, diese Lücken zu füllen.
Reflexion über das Vorgehen:
Der organisatorische Aufwand war viel grösser, als ich mir dies vorgestellt hatte. Da ich aber die Beobachtungen als äusserst bereichernd empfunden habe, möchte ich diese Methode auch in knapper bemessenen Zeitrahmen wieder durchführen. Es lohnt sich also, ein paar organisatorische Lektionen zu lernen:
– Es braucht klare Kriterien für die Auswahl der Personen. Es ist aber auch normal, dass mit mehr Themenkenntnis sich die Schwerpunkte verschieben. Schliesslich geht es um Erkenntnisse, nicht um ein proportional ‚richtiges’ Abbild.
– Wichtig ist eine überzeugende Formulierung – je nach Situation und Gegenüber leicht anzupassen – und Zielstrebigkeit beim Anfragen und Nachhaken.
– Meist ist es das Beste, direkt auf den Chef zuzugehen. Je nach Offenheit innerhalb der Firma, kann der Einbezug des Chefs aber auch hemmend wirken. Der Erfolg kann viel rascher eintreten oder vielleicht sogar komplett von der ersten Anfrage abhängen. Am unkompliziertesten – aber ja nachdem eben nicht möglich – ist es, sich ohne grosses Aufheben jemandem an die Fersen zu heften.
– Man muss sich selbst dabei sehr ernst nehmen, und nicht etwa Lockerheit gegenüber seiner Arbeit kommunizieren.
– Es ist hilfreich, von Anfang an einen Fragenkatalog zu benützen, um vergleichbare Beobachtungen festzuhalten. Je nach Erkenntnissen und Interessenentwicklung kann dieser aber immer weiter ergänzt werden.
– Um durch solche Verschiebungen nicht in Verlegenheit zu geraten, empfiehlt es sich, eine Kontaktnummer für weitere Fragen zu erbitten.
– Man sollte die Darstellungsform gleich zu Beginn bestimmen und die Beobachtungen laufend dokumentieren.
– Datenschutz und Vertraulichkeit der Informationen sind ein heikler Punkt, in der Dokumentation der Recherche. Je nachdem sind eine Autorisierung durch die betroffenen Personen wie aber auch die Änderung der Namen und Nachzeichnung der Gesichter vorstellbar.
Selbstbeobachtungen, Umfrage, Dokufilm ‚pausenlos‘
siehe > Muster
siehe > Erkenntnissgewinn