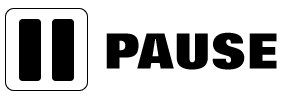Unter dem Titel ‚Selbstbeobachtungen’ bat ich einzelne ausgewählte Personen, ihre Pausen über die Dauer einer Woche in einem Raster einzuschreiben. Dabei überliess ich es bewusst den Teilnehmern, wie das genau zu tun sei: Ich sagte ihnen nur, dass es kein Richtig oder Falsch gebe und mich vor allem interessiere, was sie sich zur Erfassung der Pausen überlegten – mehr als wann und wie lange sie tatsächlich Pause machten.
Ziel:
Das Ziel war, sie dazu zu bringen, sich intensiver mit dem eigenen Zeitmanagement auseinanderzusetzen um auf diese Weise zu Gesprächspartnern für mich zu werden. Selbst füllte ich diese Bogen während drei Wochen aus und brauchte Leute, mit denen ich meine eigenen Beobachtungen vergleichen und besprechen konnte.
Vorgehen:
Als TeilnehmerInnen wählte ich verschiedene Leute aus meinem Umfeld, von denen ich wusste, dass sie anders mit ihrer Zeit umgehen. Ich bat sie einfach, mit zu machen und liess sie dann zwischen einem etwas stärker gerasterten und einen relativ leeren 7×24-Stunden-Bogen – beide mit Platz für Bemerkungen – auswählen. Ich liess ihnen auch mehr Zeit als nur diese eine Woche, fragte aber ab und zu nach dem Stand der Dinge. Wenn es gar nicht voran ging, verriet ich, dass ich in meiner eigenen Beobachtung oft die Pausen mit einer Farbe kennzeichnete.
Erlebnisse:
Es war eine sehr schwierige Aufgabe. Einige füllten das Blatt nicht aus, wobei sie sich zum Teil dann trotzdem Gedanken gemacht hatten, die sie mir dann erzählten. In den meisten Fällen dauerte es ungefähr drei Wochen. Bei den Einen dauerte es so lange, bis sie ihre Aufzeichnungs-Methode gefunden hatten, Andere vergassen zwischendurch immer wieder, Protokoll zu führen und nochmal Andere warteten jeweils absichtlich auf repräsentative Tagesstrukturen.
Ergebnisse:
Es ergaben sich spannende Gespräche darüber, was eine ‚Pause’ ist, unterschiedliche Bedürfnisse die stärker gedeckt werden sollten und die erlebte Qualität der beobachteten Zeit.
Interessanterweise schrieben schlussendlich die meisten alle konkreten Tätigkeiten durch den ganzen Tag auf, um diese dann mit verschiedenen Farben zu markieren. Sie definierten also verschiedene Zeitqualitäten: ‚echte’ Arbeit, ‚echte’ Freizeit, Pause ‚aber mit dem Kopf bei Arbeit’ und Freizeit ‚aber am Arbeiten’ (z.B. Freiwilligenarbeit) und ordneten ihre Tätigkeiten diesen zu. Wie auch in meinem Bogen treten teilweise die selben Tätigkeiten in verschiedenen Qualitäten auf.[1]
Die Gespräche mit Leuten waren tatsächlich spannender als die ausgefüllten Bogen: Was sie festgestellt hatten und weshalb sie diese Art der Erfassung sinnvoll fanden.
Dadurch, dass ich Leute fragte, die ich bereits besser kannte, war es einfacher, sie für das doch recht schwierige und selbstkritische Vorhaben zu gewinnen.
Die Effizienz wurde durch die bewusste Auswahl sicherlich erhöht (absichtliche Anfrage von Leuten mit unterschiedlichem Umgang mit Zeit) und erleichterte den offenen Austausch über die Erkenntnisse, führte aber möglicherweise auch zu weniger überraschenden Aussagen, als dies mit einer zufälligen Auswahl von Unbekannten der Fall gewesen wäre.
Es gab Leute, die das Blatt nicht ausfüllten und auch keine pointierten Gründe dafür formulieren konnten. Für diejenigen aber, mit denen ein Austausch stattfinden konnte, war es ein interessantes und bereicherndes Projekt.
Reflexion über das Vorgehen:
Selbstbeobachtungen auch mit anderen Personen durchzuführen ergab sich aus dem Bedürfnis nach Gesprächspartnern, die sich – wie ich – eingehend mit ihrer Zeiteinteilung auseinandergesetzt hatten. Diese Methode führt zu qualitativen Resultaten, die auf einer sehr persönlichen Ebene erhoben werden. Eine statistische Auswerten der Bogen macht keinen Sinn und kann somit unterlassen werden; für die Entwicklung einer Haltung hingegen ist die Diskussion interessant.
Möglicherweise geschieht in einem kollaborativen Projekt (wenn mehrere Leute gleichermassen involviert sind) dieser Austausch in (informellen) Gesprächen. In diesem Projekt aber, in dem ich als Autorin alleine arbeite, fand ich für mich diese Alternative.
Ich stelle mir vor, dass dazu nicht alle Themen ebenso geeignet wären wie ‚Pause’, zu dem jedermann und –frau täglich Erfahrungen sammelt.
Gesprächsfetzen:
Ist Nichts-Tun ‚Pause‘?
Ist nichts planen ‚Pause‘?
Ist Nichts-Zielgerichtetes-Tun ‚Pause‘?
‚Pause’ heisst ‚nicht zweckgebunden!
Essen und Schlafen sind zielgerichtet!
Es kommt auf die Pausenqualität an: Essen kann entspannend aber auch sehr stressig sein.
Fast jede Tätigkeit kann Pausenqualität haben – oder eben nicht.
Ich brauche andere Leute um ‚nichts Zielgerichtetes’ zu tun!
Für Qualität braucht es Gelassenheit.
Es braucht Qualität und Rythmus!
Wie kann man rhythmisieren ohne ständig zu unterbrechen und zu bevormunden?
Komm, wir gehen flanieren!
Ich brauche keine Ablenkung.
Ich brauche keine Entspannung, eher das Gegenteil: Spannung und Bewegung!
Interessant wird es, wenn man Zeit lässt, dass etwas einen ‚beschäftigen‘ kann. Nur so entsteht etwas neues, Neuinterpretationen. Pause ist ‚Brachzeit‘.
Weniger konsumieren – alle Einflüsse müssen verdaut werden!
Beobachtungen, Umfrage, Dokufilm ‚pausenlos‘
siehe > Muster
siehe > Erkenntnisgewinn