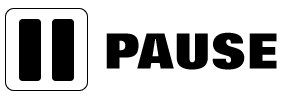Umfrage
Ziel:
Im Rahmen der Recherche führte ich eine Umfrage durch. Dabei ging es um eine qualitative und möglichst vielseitige Annäherung an Definition von Dauer, Inhalten und Funktionen von Pausen – nicht um statistische Datenerhebung.
Erlebnis:
Pause ist ein Thema, zu dem alle etwas zu sagen haben und täglich Erfahrungen sammeln. Neben Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken, die alle befriedigen müssen, gibt es sehr unterschiedliche Anforderungen an Pausen. Obwohl Zeitnot eine ‚Krankheit unserer Gesellschaft’ ist, hatten sich die meisten Befragten zuvor kaum Gedanken zu ihren Pausen gemacht. Dabei erstaunt es nicht, dass äussere Stukturen die Klarheit der Angaben zu fördern schienen. Tendenziell führen aber neue Medien und Globalisierung zu immer freierem Zeitmanagement und zur Verwischung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben.
Erkenntnisse:
Die Umfrage bestätigt die These, dass mehr Freiheit im Zeitmanagement und die (Mit-) Bestimmung der Inhalte zu höherer Einsatzbereitschaft führt. Da dies oft mit mehr Rumination (nicht abschalten können) einher geht, scheint eine geringere Erholungsfähigkeit als Folge naheliegend. Mehr Selbstbestimmung fördert aber auch das ‘Flow-Erleben’(in der Beschäftigung aufgehen), wodurch allgemein grössere Kapazitäten zur Verfügung stehen.
Typische Pausenrituale wie Kaffee, Zigaretten und Essen scheinen bei der Definition hilfreich: Durch die klare Abgrenzung von der Arbeit entsteht erst die Voraussetzung für ein Bewusstsein über die ‚erlebte Qualität’ als Pause, welche entsprechend arbeitspsychologischen Erkenntnissen für den Aufbau und Erhalt von Ressourcen (Energie, Kompetenz und Gesundheit) entscheidend ist.
Reflexion über das Vorgehen:
Die als Ziel erklärte Annäherung an die Definition ist durchaus geglückt: Erkenntnisse der Arbeitspsychologie und eigene Thesen konnten mit konkreten Aussagen untermauert oder relativiert und Schlussfolgerungen daraus als qualitative Ergänzungen in die Argumentation eingebaut werden. Die allgemeineThemengewandtheit wird somit unterstützt, wenn auch der zeitliche Aufwand bei der Auswertung handfester Resultate (für mich absolutes Neuland)eher hoch war.
Für eine nächste Anwendung dieser Methode gibt es Folgendes festzuhalten:
– Die Kenntnis existierender Studien ermöglicht eine sinnvolle (ergänzende/ untermauernde) Ausrichtung der Umfrage und die präzise Formulierung der Fragen.
– Es ist hilfreich für die Formulierung und zeitsparend für die Auswertung, wenn man sich von Anfang an Gedanken zur Darstellungsform macht.
– Zur Vereinfachung der Auswertung ist bei einer qualitativen Umfrage eine Mischung von offenen Fragen und Auswahloptionen (ja-nein-Antworten/ Skalen) sinnvoll.
– Offene Fragen sind für Auflistungen und das Erkennen von Tendenzen interessant.
– Auswahloptionen ermöglichen die klare Feststellung von Sachverhalten.
– Bewertungen über Zufriedenheit können Designvorschläge untermauern.
– Es muss auf die repräsentative Auswahl der Befragten geachtet werden (Alter, Geschlecht, …).
– Um den Auswertungsaufwand zu reduzieren, bietet sich eine elektronische Erhebung an.
– Nach einer Proberunde sollte überprüft werden, ob die Art der Aussagen den Erwartungen entspricht. Andernfalls ist eine Überarbeitung notwendig.
Beobachtungen, Selbstbeobachtungen, Dokufilm ‚pausenlos‘
siehe > Muster
siehe > Erkenntnisgewinn